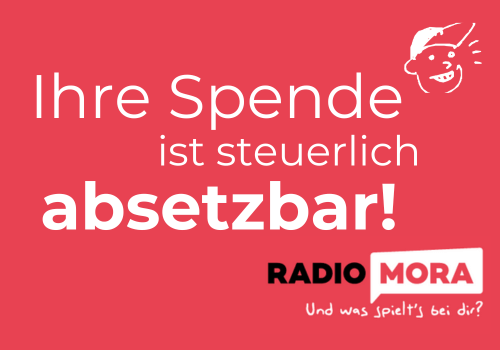„Es war ein langer Weg. Aber wir haben nie aufgegeben“

09.10.2025
Es war ein stiller Sommermorgen im Jahr 1999, als in Großwarasdorf zum ersten Mal eine zweisprachige Ortstafel aufgestellt wurde – ein unscheinbares Blechschild, das für viele Menschen dennoch ein Symbol von Würde und Sichtbarkeit war. Heute, 25 Jahre später, blicken jene, die damals mitten im Geschehen waren, mit Stolz, aber auch mit Nachdenklichkeit zurück.
„Wir haben lange darauf hingearbeitet“
Ferenc Buzanich erinnert sich noch genau an die Stimmung der damaligen Zeit. Der Aktivist war einer derjenigen, die sich schon in den 1980er-Jahren für zweisprachige Ortstafeln im Burgenland einsetzten.
„Es war ein langer Weg“, sagt er im Gespräch mit Radio-MORA-Reporterin Gesa Buzanich. „Viele Gespräche, viele Enttäuschungen. Aber wir haben nie aufgegeben.“
Die Enthüllung in Großwarasdorf – oder Veliki Borištof, wie der Ort auf Burgenlandkroatisch heißt – war der sichtbare Abschluss einer jahrzehntelangen Auseinandersetzung.
„Für uns war das keine Provokation“, betont Buzanich, „sondern einfach ein Stück Gerechtigkeit. Wir wollten nur, dass man unsere Sprache und unsere Kultur respektiert.“
Die Aufstellung der ersten zweisprachigen Tafel war damals kein großes Fest, keine offizielle Feier mit Reden und Musik. Es war vielmehr ein Moment der Ruhe – und der Erleichterung. „Ich bin in der Früh hingefahren, habe sie angeschaut und mir gedacht: Jetzt steht sie endlich da“, erzählt Buzanich leise. „Da war Stolz, aber auch Dankbarkeit.“
„Viele haben sich nicht getraut“
Auch Jakob Zvonarits war damals aktiv – als Mitglied des Kroatischen Akademikerklubs, kurz HAK, und Mitorganisator verschiedener Aktionen, die auf die fehlende Gleichbehandlung aufmerksam machen sollten. Er spricht von einer Zeit, in der Mut gefragt war:
„Viele hatten Angst, sich offen zu engagieren. Es gab immer wieder Widerstand, Drohungen, und manche wollten einfach keinen Ärger mit der Gemeinde oder den Nachbarn.“
Zvonaric beschreibt, wie die Bewegung trotz allem wuchs – Schritt für Schritt, getragen von einer jungen Generation, die die Forderungen ihrer Eltern und Großeltern weiterführte.
„Wir wollten keine Konfrontation“, sagt er. „Aber wir wollten, dass sichtbar wird, dass wir hier dazugehören. Dass man unsere Sprache auf den Schildern sieht, genauso wie im Alltag.“
Erinnerungen an eine bewegte Zeit
Beide Männer erzählen, wie eng der Kampf um die Ortstafeln mit der eigenen Identität verbunden war.
„Ich war damals noch Student“, erinnert sich Zvonarits, „und plötzlich war ich Teil einer Bewegung, die Geschichte schrieb. Wir haben Plakate gemacht, mit den Gemeinden gesprochen, Pressekonferenzen organisiert – alles ehrenamtlich, alles mit Herzblut.“
Buzanich nickt: „Es ging nicht nur um Schilder. Es ging um Respekt. Um das Gefühl, dass die Sprache meiner Eltern denselben Platz verdient wie jede andere.“ Dass dieser Wunsch bis heute nicht selbstverständlich ist, zeigt, wie tief die Frage der Zweisprachigkeit im Burgenland verwurzelt ist – und wie viel sie mit Zugehörigkeit zu tun hat.
Vom Streit zum Selbstverständnis
Rückblickend war die Aufstellung der ersten Ortstafel in Großwarasdorf ein Wendepunkt. „Plötzlich war etwas sichtbar geworden, das vorher nur diskutiert wurde“, sagt Zvonarits. „Man konnte nicht mehr so tun, als gäbe es uns nicht.“
Trotz der anfänglichen Spannungen, die auch in anderen Gemeinden spürbar waren, habe sich mit der Zeit vieles normalisiert.
„Heute ist das für die meisten selbstverständlich“, meint Buzanich. „Die Kinder wachsen mit beiden Sprachen auf, und das ist das Schönste daran.“
Der Konflikt von damals ist Teil der Geschichte geworden – aber die Erinnerung daran bleibt lebendig.
„Es war nicht immer einfach“, sagt Zvonarits, „doch wenn ich heute an der Ortstafel vorbeifahre, denke ich mir: Es hat sich gelohnt.“
„Wir wollten einfach sichtbar sein“
Was bleibt, ist ein Gefühl der Erfüllung – und die Erkenntnis, dass kleine Schritte große Wirkung haben können.
„Wir wollten kein Aufsehen, keine Revolution“, sagt Buzanich. „Wir wollten einfach sichtbar sein – als Menschen, als Burgenländer, als Kroaten.“
Zvonarits fügt hinzu: „Manchmal vergesse ich, wie viel Mut das damals gekostet hat. Aber wenn ich sehe, wie selbstverständlich die Ortstafeln heute sind, weiß ich, dass es richtig war.“
Ein Vierteljahrhundert nach jenem unscheinbaren Sommermorgen steht das Schild von Großwarasdorf immer noch – wettergegerbt, aber fest verankert. Und mit ihm auch die Erinnerung an jene, die dafür gekämpft haben, dass zwei Sprachen, zwei Kulturen und viele Geschichten ihren Platz nebeneinander finden.
Zurück zur Übersicht