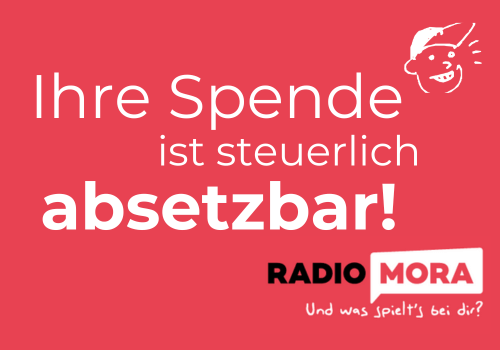Dialekt, Musik und Identität

15.10.2025
„Gscheit gscheat – gscheit gspüt“ – unter diesem Titel präsentierte der Musiker und Autor Paul Csitkovics gemeinsam mit dem Ensemble „Butz & Reineke“ ein außergewöhnliches Programm im Rathaus Oberpullendorf. Das Projekt verband Musik, Sprache und Geschichten aus dem burgenländischen Alltag zu einem Abend, der gleichermaßen unterhielt und zum Nachdenken über die sprachliche Vielfalt der Region anregte.
Klicken Sie auf den unteren Button, um den Inhalt von cba.media zu laden.
Ein Abend über Sprache und Klang
Das Publikum erlebte eine Collage aus Liedern, Texten und Tonaufnahmen, die Dialekte, Mehrsprachigkeit und die Entwicklung der regionalen Sprache in den Mittelpunkt stellten. Csitkovics, der selbst in mehreren Sprachen aufgewachsen ist, erklärte zu Beginn:
„Es geht um das, was wir reden, wie wir reden und was das über uns aussagt.“
Begleitet wurde er von Marina Petkov, Ilvi Šulčik, Finn Holzwart und Richard Hale. Gemeinsam schufen sie eine musikalisch-literarische Landschaft, die vom Burgenland über Wien bis in die Nachbarschaft der pannonischen Sprachen führte.
Die Performance war kein klassisches Konzert, sondern eine Mischung aus Dokumentation, Theater und Musik. Dazwischen wurden Interviews eingespielt – etwa mit älteren Sprecherinnen aus dem Südburgenland, die über Dialekte und Sprachwandel erzählten. So entstand ein Mosaik aus Stimmen, das deutlich machte, wie stark Sprache Identität formt.

Zwischen „g’scheit“ und „g’scheat“
Das Projekt „Gscheit gscheat – gscheit gspüt“ wurde ursprünglich als Beitrag zur Reihe „Sprache und Identität“ entwickelt. Der Titel spielt auf die unterschiedlichen Facetten des Burgenländischen an – bodenständig, humorvoll und selbstironisch.
„Dialekt ist mehr als ein Kommunikationsmittel – es ist auch ein Gefühl,“ sagte Csitkovics während der Vorstellung. Viele im Publikum nickten zustimmend. Der Musiker sprach über die Herausforderungen, Mehrsprachigkeit im Alltag zu leben, ohne dass eine Sprache die andere verdrängt. Dabei verwies er auf eigene Erfahrungen: Aufgewachsen mit Deutsch, Kroatisch und Ungarisch, spüre er heute oft, „wie sich die Sprachen gegenseitig beeinflussen, wie sie klingen, wenn man sie mischt“.
Diese Mischung war auch musikalisch hörbar. Die Band verband Volkslieder mit modernen Rhythmen, traditionelle Instrumente mit E-Gitarre und Samples von Sprachaufnahmen. Aus dem vermeintlich Gegensätzlichen entstand ein harmonisches Ganzes – ein Sinnbild dafür, wie Mehrsprachigkeit auch kulturell wirken kann.

Generationen im Gespräch
Im Mittelpunkt des Abends stand der Dialog zwischen Generationen. Junge Musikerinnen wie Marina Petkov und Ilvi Šulčik brachten neue Perspektiven ein. Petkov erzählte auf der Bühne, dass sie erst durch die Zusammenarbeit mit Csitkovics begonnen habe, sich intensiver mit ihrer eigenen sprachlichen Herkunft zu beschäftigen.
Das Publikum erlebte dabei nicht nur musikalische Qualität, sondern auch eine Form der kulturellen Selbstreflexion. In einem der eingespielten Interviews sagte eine ältere Sprecherin aus dem Mittelburgenland: „Früher hat man uns gesagt, wir sollen ordentlich Deutsch reden. Heute sagen sie: Red’s, wie ihr’s könnt – Hauptsache, ihr verliert’s es nicht.“ Dieser Satz wurde zum Leitmotiv des Abends: das Spannungsfeld zwischen Bewahren und Verändern, zwischen Tradition und Gegenwart.

Sprachbewusstsein als Zukunftsfrage
Die Veranstaltung fand im Rahmen der „Pullenale“ statt und wurde von der Stadtgemeinde und dem Land Burgenland unterstützt. 2. Vizebürgermeisterin Christina Köppel lobte das Projekt in ihrer Begrüßung als „mutigen Beitrag zur Sprachkultur im Burgenland“. Auch Kulturstadträtin Eva-Maria Kneisz betonte, wie wichtig es sei, „dass junge Künstlerinnen und Künstler sich mit Mehrsprachigkeit auseinandersetzen – nicht als Problem, sondern als Reichtum.“
Ein zentrales Thema des Abends war die Frage, wie Dialekte und Volksgruppensprachen in einer globalisierten Welt überleben können. Csitkovics verwies dabei auf den Bildungsbereich: „Wenn Kinder schon im Kindergarten erfahren, dass ihre Sprache wertvoll ist, dann tragen sie das weiter – in die Schule, ins Leben.“ Er machte klar, dass Projekte wie dieses mehr sind als Kunstaktionen – sie sind Teil einer gesellschaftlichen Bewegung, die Sprache als kulturelles Erbe versteht.

Musik als Vermittler
Musikalisch wechselten ruhige, nachdenkliche Passagen mit rhythmisch lebendigen Nummern. Texte in verschiedenen Dialekten wurden rezitiert oder gesungen. Besonders eindrucksvoll war ein Stück, in dem Originaltonaufnahmen aus Interviews mit Instrumentalklängen verwoben wurden – eine Art „Soundscape“ burgenländischer Stimmen.
Das Publikum reagierte mit großem Applaus. Viele Besucherinnen und Besucher suchten nach der Vorstellung das Gespräch mit den Musikerinnen. Eine Besucherin fasste es treffend zusammen: „Man hört diese Sprachen jeden Tag – aber selten so bewusst. Heute habe ich sie neu gehört.“
Zurück zur Übersicht