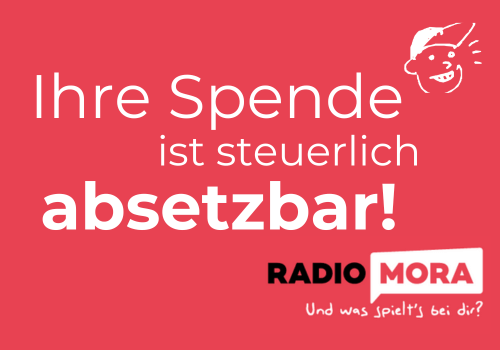„Ein sichtbares Zeichen der Gleichberechtigung“
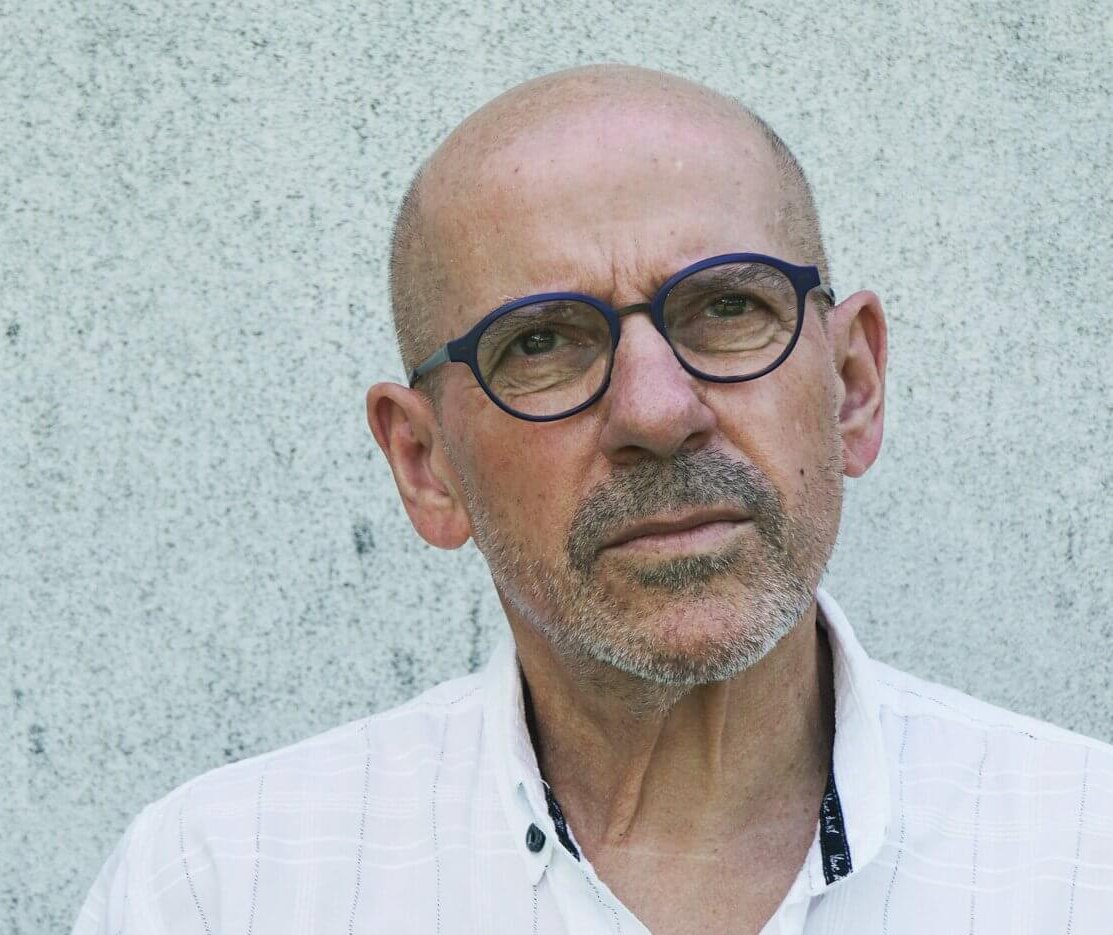
08.10.2025
Vor einem Vierteljahrhundert wurde in Großwarasdorf die erste zweisprachige Ortstafel enthüllt – in der Interview-Reihe von Radio-MORA-Redakteurin Gesa Buzanich erzählen Aktivistinnen, Aktivisten und Zeitzeugen ihre Geschichten. Den Auftakt macht Joško Vlasich, der an den steinigen Weg bis zur ersten Tafel zurückdenkt.
Am 13. Juli 2000 wurde in Großwarasdorf (Veliki Borištof) Geschichte geschrieben: Mit der Aufstellung der ersten zweisprachigen Ortstafel begann ein neues Kapitel für die burgenländischen Volksgruppen. Was jahrzehntelang politisch umkämpft war, wurde damit Wirklichkeit – 45 Jahre nach der Unterzeichnung des Staatsvertrags von 1955.
Vom Staatsvertrag zum sichtbaren Symbol
Artikel 7 des Staatsvertrags garantiert den kroatischen und slowenischen Minderheiten in Österreich das Recht auf ihre Sprache – im Unterricht, im öffentlichen Leben und auf topografischen Aufschriften. Doch bis zur Umsetzung dieses Rechts sollten Jahrzehnte vergehen. Erst die Regierung unter Bundeskanzler Wolfgang Schüssel finalisierte im Jahr 2000 den lang erwarteten Verordnungstext, den noch sein Vorgänger Viktor Klima in Begutachtung geschickt hatte.
Schüssel enthüllte schließlich am 13. Juli in Großwarasdorf die erste zweisprachige Ortstafel. „Der österreichische Reichtum drückt sich auch in seinen Volksgruppen aus“, sagte der Kanzler damals. Befürchtete Proteste blieben aus – der „Ortstafelsturm“, wie man ihn in Kärnten erlebt hatte, blieb im Burgenland aus.
„Es war höchste Zeit“ – Joško Vlasich erinnert sich
Der burgenländisch-kroatische Pädagoge, Musiker und Aktivist Joško Vlasich war einer jener, die sich schon lange zuvor für die Umsetzung des Artikels 7 einsetzten. Für ihn war die Aufstellung der Tafeln ein Moment großer Genugtuung:
„Es macht ein sehr positives Bild, wenn ich in ein Dorf mit zweisprachigem Ortsschild fahre. Das ruft in mir das Gefühl hervor, ein gleichberechtigter Bürger dieses Landes zu sein.“
Vlasich erinnert aber auch daran, dass die Ortstafeln nur ein Teil des Ganzen sind.
„Mit den Tafeln allein ist es nicht getan. Auch andere topografische Aufschriften sollten zweisprachig sein – da fehlt noch sehr vieles“, betont er.
Er schlägt vor, die sogenannte 25-Prozent-Klausel für den Anteil kroatischer oder ungarischer Bevölkerung in einer Ortschaft zu überdenken und künftig großzügiger auszulegen. Ein Zeichen der Offenheit, sagt er, wäre etwa eine viersprachige Ortstafel in der Landeshauptstadt Eisenstadt.
Vom Ortstafelsturm zur KUGA-Aktion
Vlasich blickt in dem Gespräch auch zurück auf die Zeit des „Ortstafelsturms“ in Kärnten in den 1970er-Jahren – ein Wendepunkt für viele junge Burgenlandkroaten:
„Damals sind wir aufgewacht. Wir haben erkannt, dass auch im Burgenland Artikel 7 nicht umgesetzt war.“
In den 1980er-Jahren organisierten Aktivisten schließlich kreative Protestaktionen. Unter anderem hängten Mitglieder der KUGA selbstgemachte kroatische Ortsschilder unter die offiziellen Tafeln. „Wir wollten zeigen, dass diese Tafeln niemandem etwas wegnehmen, sondern etwas hinzufügen“, so Vlasich.
Anzeigen blieben aus – und die Aktion wurde zu einem Symbol friedlichen Protests.
„45 Jahre zu spät – aber ein richtiger Schritt“
Als 2000 die erste Tafel schließlich offiziell aufgestellt wurde, mischten sich Freude und Skepsis. „Wir wussten, dass das auch politisch genutzt wird“, erinnert sich Vlasich. „Aber wir konnten dem Bundeskanzler die Tür nicht vor der Nase zuschlagen.“
Er sieht die damalige Entscheidung auch als geschickte politische Geste in einer sensiblen Zeit: Nach den EU-Sanktionen gegen Österreich nutzte die Regierung Schüssel-Haider die Gelegenheit, um ein Zeichen der Offenheit zu setzen – mit nachhaltiger Wirkung.
Fortschritte und offene Aufgaben
Heute, 25 Jahre später, sind 47 kroatische und 4 ungarische Ortstafeln im Burgenland Realität. Dazu kommen immer mehr zweisprachige Wegweiser und Beschilderungen. Doch aus Sicht von Vlasich bleibt noch viel zu tun:
„Wir verlieren Kulturgut, wenn die alten Bezeichnungen für Felder, Wege und Gebäude verschwinden. Zweisprachigkeit sollte sich auch dort zeigen.“
Sorge bereitet ihm vor allem die Zukunft der Sprache selbst. „Es gibt zu wenige ausgebildete Pädagoginnen und Pädagogen, die Kroatisch oder Ungarisch wirklich gut vermitteln können. Wenn der Staat hier nicht mehr tut, wird es schwer, die Sprache lebendig zu halten.“
„Ein Auftrag für die Zukunft“
Ein Vierteljahrhundert nach der ersten Ortstafel ist Großwarasdorf noch immer Symbolort – für den langen Weg der Gleichberechtigung und für die Verantwortung, Mehrsprachigkeit zu bewahren.
„Wenn wir zu unserer Sprache stehen, dann müssen wir sie auch leben – im Alltag, in der Schule, im öffentlichen Raum“, sagt Vlasich.
Zurück zur Übersicht